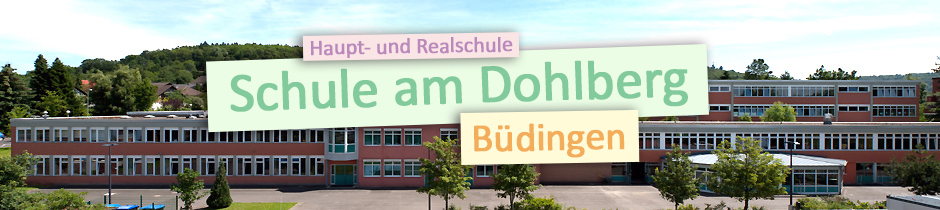
Schule am Dohlberg
In der Langgewann 3 - 5
63654 Büdingen
Sekretariat:
06042 96180
Sprechzeiten
Vertretungsplan
Auszeichnungen
Lernzeit
Das Projekt Lernzeit startete an der Schule am Dohlberg zu Beginn des Schuljahres 2014/15 in den beiden Klassen 5 der Hauptschule.
Ausschlaggebender Faktor für die Einführung der Lernzeit an unserer Schule war die mangelnde Hausaufgabenkultur, bzw. die mangelnde Fähigkeit der Schülerinnen und Schüler, strukturiert zu arbeiten. Bewusst war uns, dass der größte Bedarf im Bereich der Hauptschule liegt. Da wir die Lernzeit aufgrund mangelnder Ressourcen nicht im ganzen Jahrgang 5 (H und R), geschweige denn im gesamten Hauptschulbereich oder der gesamten Schule einführen konnten, entschieden wir uns, das Projekt im Jahrgang 5 der Hauptschule zu starten. Ein weiterer Aspekt für die Auswahl dieses Jahrgangs war die erhöhte Anzahl inklusiv zu beschulender Schülerinnen und Schüler, die wir für dieses Schuljahr im Jahrgang 5 der Hauptschule erwarteten.
Verankert wurde sie an jedem Tag in der 6. Stunde, somit fand die Lernzeit fünfmal in der Woche in zwei Klassen statt und wurde immer von einem Kollegen der Regelschule, der ein Hauptfach in der Klasse unterrichtet, beaufsichtigt. Zusätzlich wurden auch noch Kollegen der Erich-Kästner-Schule im Rahmen der BFZ-Arbeit in diesen Stunden eingesetzt.
Bis zum Schuljahr 2018/19 wurde die Lernzeit auf die Jahrgänge 5-7 der Haupt und Realschule sukzessive ausgedehnt. Durch die Erweiterung der Lernzeit auf 15 Klassen konnte diese aus organisatorischen Gründen nicht mehr immer in der 6. Schulstunde stattfinden und wurde daher zum Teil auf die 7. oder 8. Schulstunde verlegt. Betreut wird die Lernzeit in der Hauptschule immer durch eine Lehrkraft der Klasse und im Jahrgang 5 und 6 immer mit Unterstützung einer BFZ-Lehrkraft. Im Jahrgang 7H nimmt eine BFZ Kraft in diesen Stunden die Förderschüler abwechselnd aus beiden Klassen in die Förderung.
In der Realschule findet die Lernzeit im Jahrgang 5 und 6 fünf Mal statt und im Jahrgang 7 drei Mal. Hier wird die Lernzeit von einer Lehrkraft der Klasse betreut.
Organisation
-
die Teilnahme ist verpflichtend
-
fünfmal in der Woche (in der R7 nur dreimal pro Woche), dadurch 2x je 2 Stunden Nachmittagsunterricht
-
in den Klassenräumen und im Klassenverband
-
Schülerinnen und Schüler arbeiten still, alleine und selbstständig
-
eine Lehrkraft führt Aufsicht, berät und leitet an
-
eine BFZ-Lehrkraft unterstützt im Bereich der Hauptschule die Schülerinnen und Schüler, die inklusiv beschult werden.
Inhalte
-
Priorität eins: strukturiertes Arbeiten erlernen und verfestigen.
-
Priorität zwei: Erledigung der Hausaufgaben in der Lernzeit.
-
die Fachlehrer erteilen und kontrollieren die Aufgaben
-
die Zeit kann auch als individuelle Übungszeit genutzt werden (z.B. Vokabeln, vor Klassenarbeiten)
-
inklusiv beschulte Kinder erhalten während der Lernzeit zusätzliche, angeleitete Übungszeiten
-
die anwesende Lehrkraft führt Aufsicht, sorgt für eine ruhige Arbeitsatmosphäre und steht in Einzelfällen für Rückfragen der Schüler zur Verfügung
-
Aufgabentafel im Klassenraum, Checkliste und Schuljahresplaner dienen als Strukturierungs- undKommunikationsmittel
Was wir von den Schülerinnen und Schülern erwarten
-
stilles Arbeiten
-
selbstständiges Arbeiten
-
Rückfragen nur gezielt, d.h. „Was genau habe ich nicht verstanden?“
-
Fragen oder notwendige Kommunikation nur im Flüsterton
-
die Bearbeitung von zusätzlichen Arbeitsblättern zu Übungszwecken
Was wir von den Eltern erwarten
-
regelmäßige (einmal pro Woche) Kontrolle des Schuljahresplaners mit Unterschrift
Ergebnis nach vier Schuljahren (Evaluation)
-
Ausschließlich positives Feedback in der Schulgemeinde und der Öffentlichkeit.
-
Die Fähigkeit einer selbstständigen Planung der Hausaufgaben wurde bei einem Großteil der Schülerinnen und Schülern erreicht.
-
Eine Festigung im Umgang mit dem Schuljahresplaner, der Checkliste und der Aufgabentafel ist dennoch immer wieder notwendig.
-
Enormer Lernzuwachs bei allen Schülerinnen und Schülern.
-
Erfolgserlebnisse für Schülerinnen und Schüler.
-
Intensive Arbeit am Thema Inklusion durch „gelebte“ Kooperation mit dem BFZ (Erich-Kästner-Schule Ortenberg)
-
Reduzierung der Fehlzeiten von Schülerinnen und Schülern.
-
Konfliktbewältigung durch entspannten Umgang miteinander.
-
Die Aufgabe der Schulsozialarbeit verlagert sich von Konfliktbewältigung in Richtung Unterstützung der Schülerinnen und Schüler.
-
Planungssicherheit im Falle einer Berufstätigkeit der Eltern durch den Verbleib der Schülerinnen und Schüler an zwei weiteren Nachmittagen in der Schule.
Großes Interesse an der Lernzeit wird immer wieder am Tag der offenen Tür von Eltern der Neuzugänge gezeigt.










